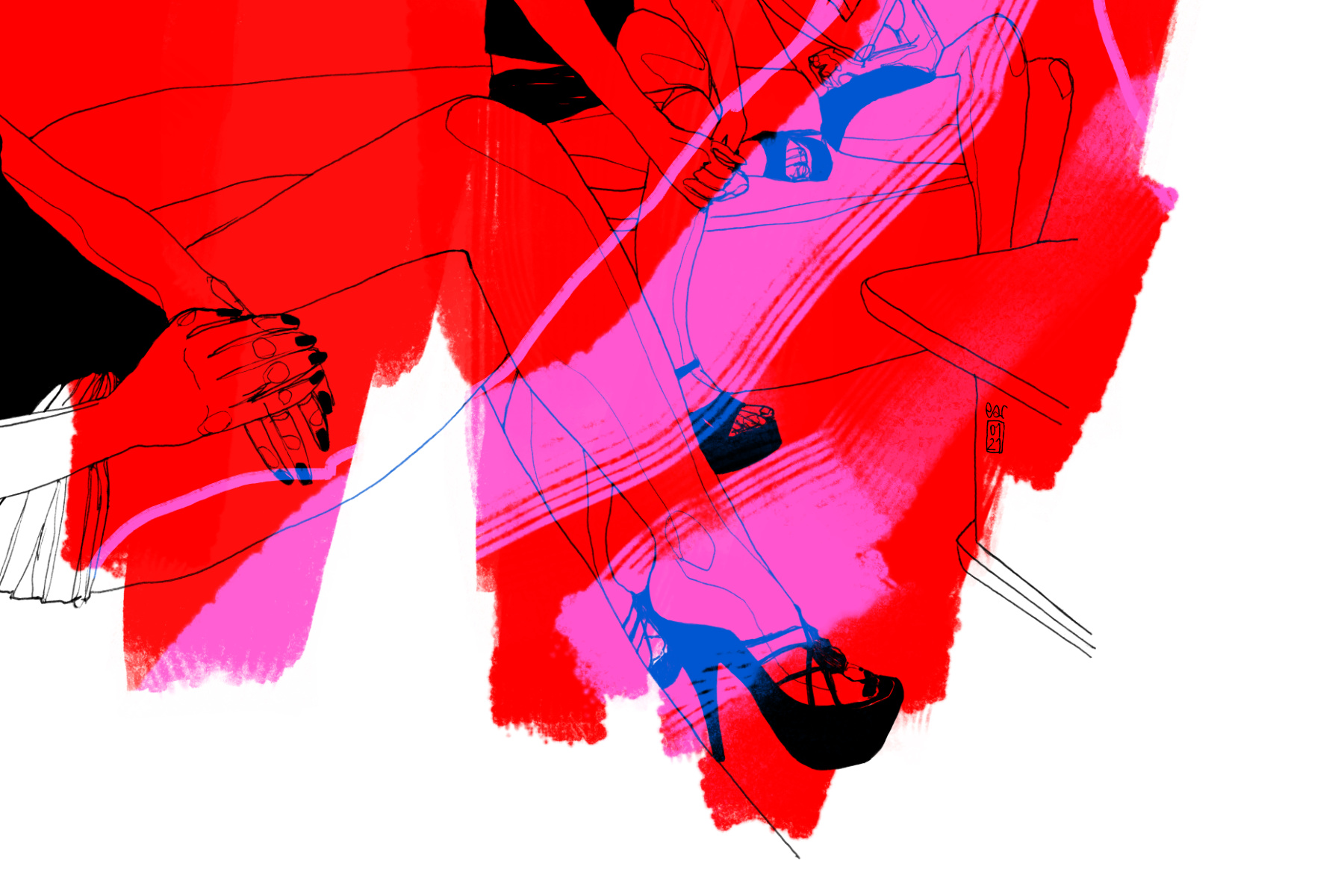Im Zuge der Corona-Pandemie wurde unter anderem die Debatte um den Wert von Care-Arbeit befeuert. Wie wichtig diese Berufe sind, hat sich in der Krise gezeigt. Wertschätzung gab es dennoch wenig. Wissenschaftler:innen befürchten sogar einen feministischen Backlash. Am härtesten hat es eine Branche getroffen, die vielerorts nicht mal als Arbeit anerkannt wird – die Sexarbeit.
Es ist Anfang Mai, als Eva van Rahden Lebensmittelspenden für Menschen zusammenstellt, die wenige Wochen zuvor noch eine Familie ernähren konnten. Darin: Grundnahrungsmittel wie Öl, Tomatensoße und Milch, aber auch Hygiene-Produkte wie Klopapier und Binden. Über 1000 dieser Gutscheine und Pakete im Wert von bis zu 100 Euro wird sie in den kommenden Monaten mit ihrem Team des Beratungszentrums für Sexarbeiter:innen in Wien, dem SOPHIE, aushändigen. „Humanitäre Hilfe", nennt sie das. Es ist ihre Antwort auf eine Frage, die während der Pandemie von den meisten Menschen nie gestellt wurde.
Was passiert mit der Sexarbeit?
Shiva Prugger, die sonst mit weicher Stimme langsam und geduldig spricht, wird wütend am Telefon. Aufmerksam verfolgte sie die Verordnungen der Regierung als sich der erste Lockdown in Österreich Mitte März anbahnte. Da war von Friseursalons die Rede, von Massage- und Nagelstudios. Die mussten als „körpernahe Tätigkeiten" natürlich sofort schließen. „Die Sexarbeit wurde schlicht nicht erwähnt - als gäbe es uns nicht“, sagt Prugger, „ich zahle Steuern, ich bin angemeldet, ich zahle Sozialversicherung. Einen ganzen Berufszweig nicht mal zu erwähnen – das hat mich sehr geärgert.“ Seit sechs Jahren arbeitet die 44-Jährige als selbstständige Domina. Sie schloss ihr Lokal in der Wiener Innenstadt auf unbestimmte Zeit und beantragte Härtefallfonds sowie einen Fixkostenzuschuss für ihr Studio. Auf Teile der Auszahlung wartet sie heute noch.
Rund 8000 Personen sind in Österreich als Sexarbeiter:innen gemeldet. Das Dunkelfeld sei schwer erfassbar, gerade im hochpreisigen Escort-Segment. In den Monaten der Lockdowns klingelte Eva van Rahdens Telefon bei SOPHIE durchgängig. Kein österreichisches Konto, keine Steuernummer, kein Einkommensnachweis – kein Anspruch auf Unterstützung. Gerade am Land sei die Situation dramatisch gewesen: „Wir hatten Frauen in Betreuung aus Rumänien zum Beispiel, die nicht zurück zu ihren Familien konnten.“ Obwohl die Arbeit zwischen Juli und November wieder aufgenommen werden konnte, hätten viele Sexarbeiter:innen noch immer hohe Schulden. Van Rahden beobachtete außerdem: „Je länger der Lockdown dauert, desto mehr kommt es zu einer Verdrängung in den illegalen Bereich. Die Armutsbetroffenheit steigt mit jedem Tag des Lockdowns.“ Auch im zweiten Lockdown, der seit Anfang November in Kraft war, blieb es rechtsverbindlich unklar, ob zumindest Hausbesuche erlaubt waren. Van Rahden befürchtet, dass viele Sexarbeiter:innen dieses Jahr Privatinsolvenz anmelden müssen.
Der Kampf um Definitionsmacht ist ein Kampf um den Wert der Arbeit selbst
Die Debatte um Sexarbeit ist moralisch seit jeher aufgeladen und deshalb ein schwieriges politisches Steckenpferd. Glühende Feminist:innen wie Alice Schwarzer behaupten, sie sei als Ausgeburt des Patriarchats von Gewalt und Unterdrückung geprägt wie kein anderes Berufsfeld. Glühende Feminist:innen fordern auch, dass Sexarbeit als Arbeit anerkannt, wertgeschätzt und normalisiert wird. Nicht selten entbrennt daraus ein Streit um den richtigen, den besseren Feminismus. Und während sich dieser Streit in Ideologien verrennt, Verbote fordert und Manifeste hervorbringt, bleiben die Betroffenen oft ungefragt zurück. Den Kampf um die Definitionsmacht führen oftmals besser situierte Sexarbeiter:innen, Politiker:innen und Alt-Feminist:innen. Extrem prekarisierte, illegalisierte und migrantische Perspektiven kommen selten zu Wort. Die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen, die fehlende Lobby und der Paternalismus, der diesem Diskurs zugrunde liegt, zeigte sich selten so deutlich wie in der Corona-Krise.
Die Frage nach der „Systemrelevanz“ während der Pandemie scheint zynisch, schaut man sich Antworten darauf in der Vergangenheit an: Während in der Wirtschaftskrise 2009 die Banken mit Milliardenbeträgen als „systemrelevant“ bezeichnet und gerettet wurden, bekommen Pflegekräfte und Gesundheitspersonal in der aktuellen Krise ab Jänner 2021 eine Lohnerhöhung von 2,08 Prozent und Applaus von Balkonen. Der Begriff der „Relevanz“ entleert sich im historischen Vergleich. Seine politischen Folgen sind abhängig vom ökonomischen Wert der jeweiligen Arbeit selbst und der ideellen Wertschätzung gegenüber jenen, die sie ausführen. Es lohnt sich deshalb, genauer hinzusehen, worin diese „systemrelevante“ Arbeit konkret besteht und wer sie ausführt. Die existenziellen Nöte in der Sexarbeit zeigen dabei nur die Spitze einer Prekarisierungsspirale, die auch vor Corona schon da, aber weniger sichtbar war.
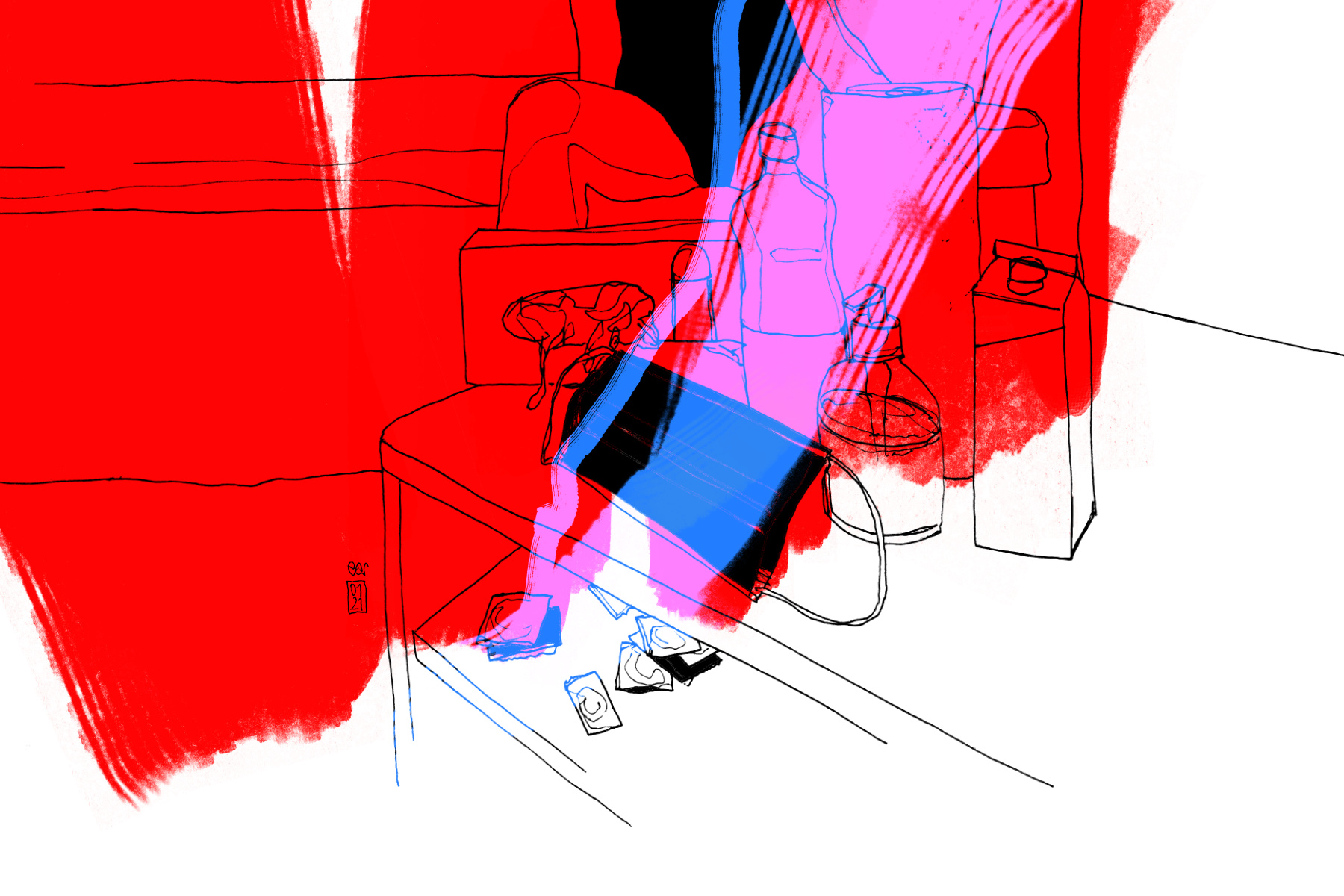
Die Abwertung von Care-Arbeit ist historisch gewachsen
Die Sexarbeiterin Shiva Prugger erzählt, sie habe sich in der Krise „nicht gesehen“ gefühlt. Prostitution, das war schon immer Teil eines Bereichs der „unsichtbaren Arbeit“. Das Nicht-Gesehen-Werden hat dabei nicht nur mit der moralischen Aufladung des Berufszweigs zu tun, sondern auch mit dem Geschlecht der meisten dort arbeitenden Menschen. Weiblich konnotierte Berufe wie Pflege, Putzkräfte oder Kindergärtner:innen – sie alle fallen in den Bereich der sogenannten Care-Arbeit. Felder, in denen mehrheitlich Frauen und Migrant:innen arbeiten. Es sind oft körperbezogene Arbeiten, die notwendig sind, damit andere Menschen überhaupt arbeiten können und die sich nicht ins Ausland verlagern lassen. Produkt und Produzent:in lassen sich in diesem Bereich nicht trennen, da Arbeitende den eigenen Körper als Tool einsetzen oder direkte Arbeit am Körper anderer verrichten. Emotionen und zwischenmenschliche Beziehungen sind ein wichtiges Qualitätsmerkmal dieser Arbeiten – sie sind aber nicht unbedingt intrinsische Motivation.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Mader warnt davor, Care-Arbeiter:innen die Motivation zu unterstellen, sie würden diese Berufe aus reiner Fürsorge um andere wählen. Gerade für Personal aus strukturschwachen Ländern könne auch einfach die höhere Bezahlung und geringe Ausbildungsanforderungen eine legitime Motivation sein, im Ausland im Niedriglohnsektor der Care-Berufe zu arbeiten. An der Wirtschaftsuniversität Wien forscht Mader unter anderem zu Feministischer Ökonomie, Care-Ökonomie und unbezahlter Arbeit. Dass ausgerechnet Menschen in Care-Arbeitsberufen in der Krise wenig Wertschätzung erfahren, sei genauso historisch gewachsen, wie alle patriarchalen Strukturen in der heutigen Arbeitswelt.
Mader fasst das so zusammen: Mit der Industrialisierung teilte sich das gesellschaftliche Leben in Erwerbs- und Privatsphäre, wobei Frauen eher dem Privaten und Männer der Arbeitswelt zugeordnet wurden, ungeachtet der Tatsache, dass Frauen zuhause unbezahlt permanent arbeiteten. Nachdem im 20. Jahrhundert auch Frauen erwerbstätig wurden – und spätestens mit der zweiten Frauenbewegung in den 68er Jahren – lösten sich zuvor klassisch feminin besetzte Bereiche unbezahlter Arbeit wie Pflege, Reinigung oder Kindererziehung aus dem familiären Kontext. Gleichzeitig drängten Frauen in diese Berufe, da sie zwar keine sonderlich hohe Bezahlung versprachen, dafür aber wenig Ausbildungsanforderungen stellten.
Was war zuerst da: Die Abwertung dieser Berufe oder die vielen Frauen in diesen Berufen?
Warum das so ist, kann Mader nur mutmaßen: „Es ist eine Huhn-Ei-Frage. Was war zuerst da: Die Abwertung dieser Berufe oder die vielen Frauen in diesen Berufen?“ Patriarchale Strukturen verstärken die andauernde Ungleichheit: Die Unterstellung, Frauen könnten diese Berufe ohnehin praktisch naturgemäß besser ausführen, hält sich als Stereotyp bis heute hartnäckig. Das Absprechen von Professionalität sowie geringe Aufstiegschancen führen zu wenig beruflichem Prestige, obwohl die meisten Menschen in ihrem Leben früher oder später mal von diesen Berufen abhängig sein werden.
Raus aus der Unsichtbarkeit
Dass auch die Sexarbeit in den Beruf der Care-Arbeit fällt, ist für Shiva Prugger eindeutig. „Sex ist nicht immer das Hauptthema von Menschen, die Sexarbeiterinnen aufsuchen. Es geht um den zwischenmenschlichen Kontakt, ums Reden, um Berührung, um Vertrauen“, sagt sie. Zehn Jahre arbeitete sie bei einer Sexhotline, verkaufte getragene Unterwäsche und fand schließlich Gefallen an BDSM. In ihrer heutigen Arbeit helfe das abgeschlossene Psychologiestudium sehr: „Es ist eigentlich angewandte Psychologie, was ich tue. Man muss sehr intime Gespräche mit den Kunden führen, die sie so mit niemandem sonst haben können.“ Als weisse Frau mit abgeschlossenem Studium und eigenem Lokal gehöre sie sicherlich zu den Privilegierteren in der Branche, da ist sich Prugger bewusst. Vier Monate konnte sie zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown zum Ende des Jahres wieder arbeiten. Dass andere Frauen die Lebensmittelspenden von SOPHIE in Anspruch nehmen mussten, ist für sie ein Armutszeugnis der Regierung. Doch statt sich von der extremen Notlage lähmen zu lassen, wurde Prugger aktiv. Mit anderen Sexarbeiter:innen gründete sie die erste Berufsvertretung für Sexarbeit in Österreich. Ihr Ziel: „Wir wollen, dass man mit uns spricht statt über uns. Ich glaube nicht, dass ich die Normalisierung dieses Berufes noch erleben werde, aber ich kann meinen Teil dazu beitragen.“
Seit dem 3. November sind in Österreich Einrichtungen zur Ausübung der Prostitution wieder geschlossen. Beraterin Eva van Rahden warnt schon jetzt vor den Folgen: „Je stärker der ökonomische Druck ist, desto größer wird die Gefahr, dass auch unsicherere Praktiken angeboten werden. Es ist meine tiefe Überzeugung: Je mehr legale Arbeitsplätze es gibt, desto größer ist der Schutz vor Ausbeutung. Wenn es keine Alternativen gibt, ist man von schlechten Rahmenbedingungen abhängig.“ Schon jetzt hätten vor allem kleine Läden mit guten Arbeitsbedingungen den ersten Lockdown nicht überstanden. Dass die Branche auf eine Pandemie besser reagieren könne als jede andere, habe sie in den 80er Jahren bereits bewiesen, als HIV noch eine tödliche Krankheit war. „Selbst da ist es gelungen, dass die Branche nicht in einen Lockdown gehen musste“, sagt van Rahden, „das ist eine Branche, die sich sehr gut mit Hygieneregeln auskennt, und die sich und ihre Kunden sehr gut schützen kann.“
Krisen werfen Gleichstellungsbestrebungen zurück.
Für die Sexarbeiter:innen in Österreich bleibt die Zukunft ungewiss. Für feministische Bestrebungen sieht es nicht unbedingt besser aus, sagt Wirtschaftswissenschaftlerin Mader: „Krisen werfen Gleichstellungsbestrebungen immer zurück oder machen sie gar zunichte.“ Durch die Einkommensausfälle würden viele Tätigkeiten wie Kinderbetreuung oder Reinigung zurück ins Private gedrängt, wo wiederum zumeist Frauen diese Tätigkeiten übernehmen. Mit dieser potenziellen Re-Traditionalisierung befürchtet Mader einen feministischen Rückschlag.
Laut Eva van Rahden gab es im 2. Lockdown eine Gruppe von Frauen, die Ansprüche aus dem Härtefallfonds hatten, ebenfalls gab es eine kleine Gruppe von Frauen, die als Betreiberin eines eigenen Lokals auch Ansprüche auf Umsatzersatz hatten. Jedoch gab es eine große Gruppe von Frauen in Beratung und Betreuung, die keinerlei Ansprüche geltend machen konnten. Hier konnte lediglich in kleinem Umfang humanitäre Hilfe geleistet werden. Die Not hat eher zugenommen, da viele Frauen noch Schulden aus dem ersten Lockdown hatten, und die Zeit bis zum 2. Lockdown zu kurz war, um diese abzubauen. "Wir nehmen in der Gruppe von Sexarbeiter:innen, die wir betreuen, eine zunehmende Verzweiflung wahr. Zumal es ja bis auf weiteres keine Aussicht auf Besserung gibt", so van Rahden. Wichtig wäre für die Gruppe, dass sie gleichzeitig mit anderen körpernahen Dienstleistungen wieder zu arbeiten beginnen können und es keine längeren Schließzeiten für diesen Bereich gäbe.
Die weiteren Schritte sind bei Sexarbeiterin Prugger längst in Planung. Mit der neu gegründeten Berufsvertretung geht sie einmal mehr in die Öffentlichkeit. "Ich werde es vielleicht nicht mehr erleben, aber mein Ziel ist klar: ich will, dass ich irgendwann von meinem Beruf erzählen kann, ohne stigmatisiert zu werden."