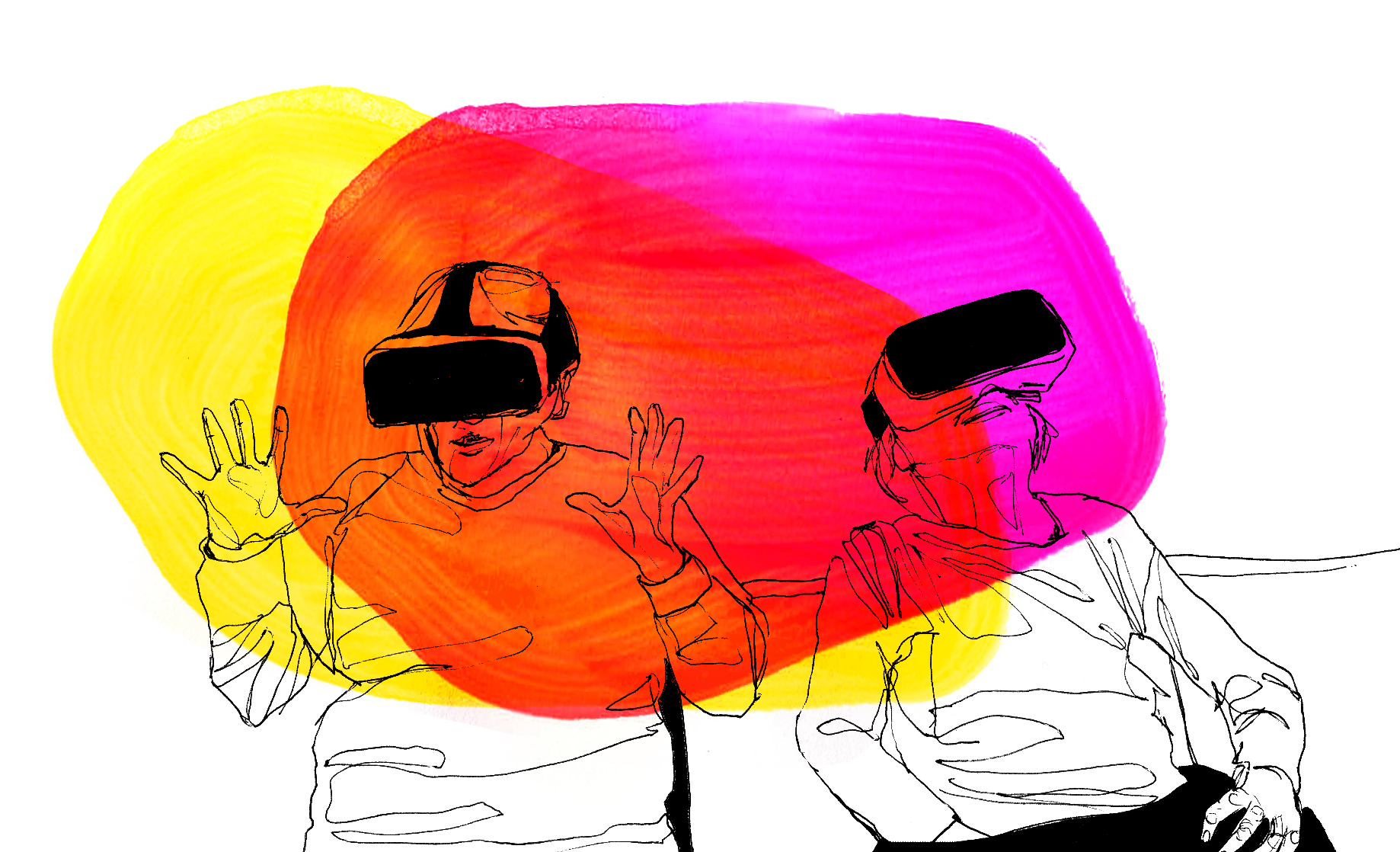„Eigentlich ist das respektlos gegenüber den Menschen, die wir betreuen“, sagt Csilla F. Csilla ist 24-Stunden-Betreuerin. Sie lebt mit alten oder hilfsbedürftigen Menschen, leistet Gesellschaft, kocht für sie, hilft beim Waschen und Medikamente einnehmen. Csilla liebt ihren Job. Eigentlich. Doch die Rahmenbedingungen, in denen sie arbeiten muss, machen es ihr schwer, den Beruf gut zu machen.
Csilla hat keine Ausbildung und was sie macht, wird nicht kontrolliert. Bis zu 24 Stunden am Tag ist sie rufbereit. Zeit für ihr Privatleben bleibt fast keine. Noch dazu bekommt sie einen extrem geringen Stundenlohn. An ihrem Alltag zeigt sich, wo die Probleme der Pflege liegen.
Seit mehr als 20 Jahren pendelt Csilla von der Slowakei nach Österreich, um ältere und hilfsbedürftige Menschen zu versorgen. „Ich liebe es, so für die Menschen da zu sein“, sagt sie. Trotzdem: Würde sie eine andere Arbeit finden, würde sie ihren Job aufgeben.
„Es gibt nicht genügend Menschen, die diesen Job unter den herrschenden Bedingungen machen wollen.“
Wie Csilla geht es vielen: Aufgrund der Bedingungen wollen immer weniger Menschen in der Pflege und Betreuung arbeiten. Laut einer Bedarfsprognose für Österreich wird der Bedarf an Pflege und Betreuung aber zunehmen: Aktuell sind etwa 127.000 Personen in der Pflege beschäftigt. Eine Studie der „Gesundheit Österreich GmbH“ geht bis 2030 von einem zusätzlichen Bedarf von 75.700 Kräften aus. Spätestens ab 2024 könne nicht mehr davon ausgegangen werden, dass der Bedarf gedeckt werden könne.
„Es gibt nicht genügend Menschen, die diesen Job unter den herrschenden Bedingungen machen wollen“, sagt Gesundheitsökonomin Monika Riedel. Sie ist Volkswirtin und forscht zu Finanzierungsmodellen für die Pflege. Sie weiß: Die Pflegekräfte müssen aktuell unter großem Zeitdruck arbeiten und bekommen dazu verhältnismäßig geringen Lohn.
Ein:e 24-Stunden-Betreuer:in muss laut „AMS“ mit einem Einstiegsgehalt zwischen € 1.670, und € 1.780,- rechnen, ein:e Diplomierte Gesundheit- und Krankenpfleger:in mit einem Gehalt zwischen € 1.570,-und € 2.260. Schon jetzt gibt es einen Fachkräftemangel, doch mit dem demographischen Wandel werde der Druck auf das Finanzierungssystem in den nächsten Jahren steigen: „Die Menschen werden älter, die Familienstrukturen und Gewohnheiten ändern sich“, so Riedel. Wenn es so weiter geht wie bisher, steht Österreich eine Pflegekrise bevor. Wie lässt sie sich verhindern?

„Es gibt viele Lösungen“, sagt Richard Stern. Für den Fachexperten für Digitale Innovation beim Kuratiorium der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser ist Technologie zentral für die Zukunft des Pflegeberufs. Sein Team überlegt, wie Digitalisierung die Pflege entlasten und – das betont Stern – das Leben der Menschen verbessern kann.
Vielleicht schaut die Zukunft der Pflege dann so aus: Die 106-jährige Martina F. frühstückt Semmeln und Marmelade, wie immer. Eine Pflegekraft begleitet sie in den Aufenthaltsraum, erstmal spielt sie zwei Runden Karten mit ihren Freundinnen Hildegard und Sara von nebenan. Nach einer kurzen Kaffeepause steht sie auf und fährt fünf Mal hintereinander den Kitzbühler Hahnenkamm hinunter. Klingt unmöglich? In Wiens Pensionisten-Wohnhäusern soll das mehr und mehr Alltag werden. Seit rund einem Jahr hat jedes Haus eine Virtual-Reality-Brille. So können Menschen, die längst nicht mehr alleine zum Supermarkt können, einen Berggipfel sehen, demente Personen alte Wege wieder gehen und 106-Jährige Schifahren. „Diese Brillen ermöglichen Lebensqualität“, sagt Stern. Das erleichtert den Pflege- und Betreuungskräften ihre Arbeit, denn neben Körperpflege, Medikamentengaben und vielen anderen Aufgaben sind sie auch für die Freizeit der Betreuten zuständig.
Neben Virtual-Reality-Brillen soll bald ein Projekt anlaufen, das diverse Technologien zur Unterstützung der Bewohner:innen testet. Zum Beispiel Bettauflagen, die erkennen können, ob eine pflegebedürftige Person das Bett zu einer unüblichen Zeit verlässt. In diesen Decken ist ein Sensor eingebaut, der dann Angehörigen oder Pflegenden Bescheid gibt, dass es zu einer ungewöhnlichen Aktivität gekommen ist.
„Die Generation 65+ möchte selbstständig leben. Durch die Digitalisierung haben sie darauf sehr viel mehr Chancen.“
Stern sieht auch darin vor allem eine Entlastung für die Pflegekräfte, denn die soziale Komponente – der Kontakt zu den Menschen – werde als Aufgabe für die Pflege bleiben. Doch die Technologie könne entlasten: „Dann muss eine Pflegekraft zum Beispiel nicht mehrmals am Tag zehn Minuten zum Fiebermessen zu einer Bewohnerin kommen“, erklärt Stern. Das könnte ein automatischer Thermometer übernehmen, der leicht zu bedienen ist und diese Routinetätigkeit übernimmt. „So ist vielleicht ein Besuch möglich, bei dem sich die Pflegekraft intensiv Zeit für ein Gespräch mit der Person nehmen kann.“
Ein anderes Einsatzfeld solcher Technologien ist für Stern das Leben zuhause. Fieberthermometer, spezielle Bettauflagen und etliche andere Assistenzgeräte bieten alternden Menschen, die das möchten, eine Möglichkeit, länger alleine zu leben. „Die Generation 65+ möchte selbstständig leben. Durch die Digitalisierung haben sie darauf sehr viel mehr Chancen,“ sagt Stern.
Menschen möglichst lange zuhause betreuen, das hält auch Monika Riedel für zentral. „Viele alternde Menschen wünschen sich dieses Modell,“ sagt sie. Doch gerade die Betreuung zuhause, die für Stern und Riedl Zukunftsmodell ist, ist ein relativ neues und ungeregeltes Feld.
„Es gibt nur wenige Gesetze, die die Qualität der Betreuung sichern und die Betreuer:innen schützen.“
Modelle wie die 24-Stunden-Betreuung, eines der häufigsten in diesem Bereich, funktionieren nur, weil Menschen wie Csilla ausbeuterische Bedingungen in Kauf nehmen müssen: Es gibt nur wenige Gesetze, die die Qualität der Betreuung sichern und die Betreuer:innen schützen. „In den 20 Jahren, die ich den Job mache, bin ich fast noch nie kontrolliert worden“, sagt Betreuerin Csilla. „Es ist, als wäre es den Österreicher:innen egal, ob die Betreuung schlecht ist.” Oft wissen weder die Betreuer:innen noch die Familien, in die sie kommen, was die Betreuer:innen dürfen und was nicht. Ihr Gewerbe ist nicht geschützt, die Agenturen, die die Frauen, die meist aus dem Ausland kommen, vermitteln und betreuen sollen, denken oft vor allem an die Familien bzw. Klient:innen. „Von uns gibt es so viele“, sagt Csilla. „Es findet sich immer jemand, der akzeptiert, was ich nicht akzeptieren möchte.“
Einmal betreute sie einen alten Mann, der ehemaliger Alkoholiker und sehr aggressiv war. Als sie versuchte, mit seiner Familie darüber zu sprechen, wurde sie gefeuert. „Zum Glück“, sagt Csilla heute. „Ich war Anfängerin und hätte mir das ewig gefallen lassen.“ Geholfen oder geschützt wurde Csilla von niemandem, stattdessen stand sie ohne Job und Schlafplatz – weit weg von ihrer Heimat – vor der Tür.
Geschichten wie Csillas kennt Simona Durisova von der IG-24 gut. „24-Stunden-Betreuer:innen sind nicht wirklich selbstständig“, sagt sie. Die Organisation hat sich während der COVID-19-Pandemie gegründet und will eine Interessensvertretung für 24-Stunden-Betreuer:innen sein. Eigentlich seien sie Angestellte, doch aus Kostengründen habe sich das Modell der Selbständigkeit durchgesetzt – zum Nachteil der Betreuer:innen. „Wir haben es hier mit einem strukturellen Problem der Scheinselbstständigkeit zu tun.“ Die Betreuer:innen können nur in Ausnahmefällen mehr als ein:e Klient:in betreuen und somit nicht mehr Gewinn machen, so Durisova. Damit sei klar: Frauen wie Csilla F. sind nicht wirklich selbstständig und werden so in eine unfaire Position gebracht. Es fehle an wirklicher Vertretung, denn in der Wirtschaftskammer sind die Agenturen und die Betreuer:innen gemeinsam vertreten, obwohl sie unterschiedliche Interessen haben. „Die Agenturen denken vor allem an die Klient:innen,“ sagt Durisova. „Wir brauchen endlich echte Vertretung. “
Neben einer Aufwertung und Umorganisation bestehender Modelle, halten Expert:innen wie Monika Riedel neue Modelle der Betreuung und Pflege für zentral: „Damit die Pflege und Betreuung in Zukunft gut bewältigt werden können, brauchen wir eine große Vielfalt an Lösungsmodellen.“ Besonders in der Betreuung zuhause brauche es unterschiedliche Modelle.
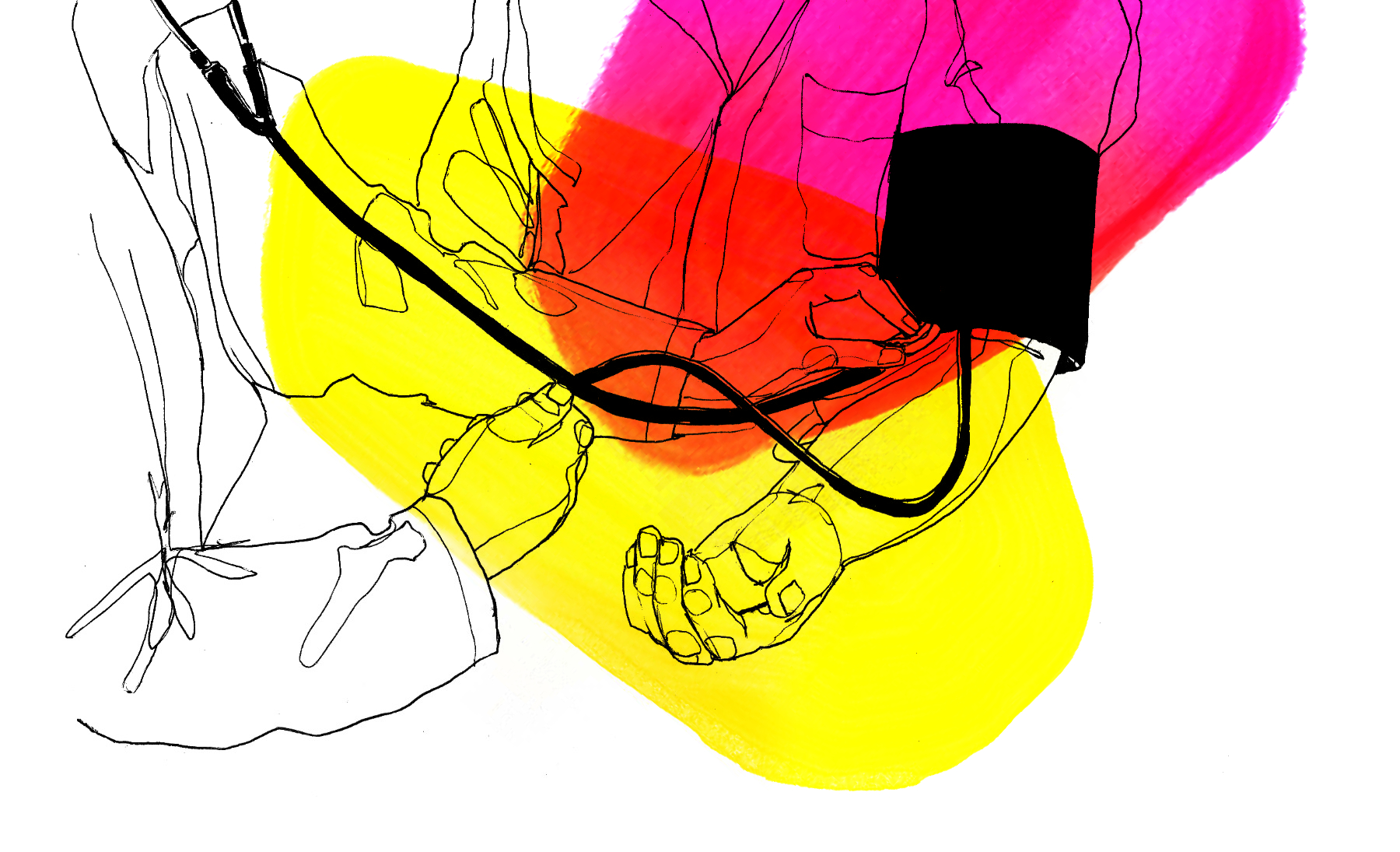
Eine Idee dazu kommt von Wohnbuddy, einer Plattform, die älteren Menschen sowie Senioren- und Pflegewohnhäusern junge Wohnpartner:innen vermittelt. Das sind oft junge Menschen in Ausbildung, zum Beispiel Studierende.
So entstehen WGs zwischen jungen und älteren Menschen. Zwei von ihnen sind Imad und Charlotte. Die beiden Studierenden wohnen seit Oktober 2020 in einem Pensionistenwohnhaus. Dabei haben sie viel gelernt. Das erste? Fernsehzeitschriften sind eine Überlebensnotwendigkeit. Imads Nachbar, ein Mann um die achtzig, bat den Studenten gleich am ersten Tag, ihm vom Einkaufen eine solche Zeitschrift mitzunehmen – Imad entdeckte damit eine neue Welt.
Imad hatte vor dem Einzug über ein Projekt in einem Tageszentrum Kontakte zu älteren Menschen. Als er dann, gerade auf Wohnungssuche, auf Social Media von dem Projekt erfuhr, dachte er sich: Das wäre doch etwas für uns. So kamen Imad und Charlotte ins Pensionistenwohnheim.
180 Menschen wohnen in dem 70er-Jahre-Bau. Es ist ein weißes Haus mit grünen Fenstern, mitten im vierten Bezirk. Zwei der großen Fenster gehören Charlotte und Imad. Für 44 Quadratmeter zahlen sie 220 Euro pro Person im Monat für die Betriebskosten. Die Küchen teilen sie sich mit den Nachbar:innen, verwendet wird sie aber fast nur von ihnen. Sie sind aber nicht wegen des Geldes eingezogen. „Natürlich ist es finanziell attraktiv, aber wir dachten uns auch: So eine Gelegenheit bekommt man nur einmal im Leben“, sagt Charlotte. Anfang 2020 habe sie sich ein bisschen verloren gefühlt. Das Pensionistenwohnheim hat das verändert. „Mittlerweile bin ich viel glücklicher.“
In den ersten Wochen nach dem Einzug habe es viele Überraschungen wie die Fernsehzeitschriften gegeben. Charlotte und Imad genießen das, genießen es, Menschen kennenzulernen, die ein anderes Tempo haben, um zwölf Mittagessen, „Mensch ärgere Dich nicht“ spielen und für alles Zeit zu haben scheinen. „Vor allem, wenn ich gestresst bin, tut es gut, für den Kontakt mit diesen Menschen Zeit zu haben“, sagt Charlotte. „Es ist Entschleunigung“, sagt Imad.
Jede Woche arbeiten die beiden fünf Stunden ehrenamtlich im Heim. Diese Zeit verbringen sie vor allem in sogenannten „Tagfamilien“, das sind Gruppen für Menschen, die nicht mehr selbstständig ihren Tag gestalten können. Viele von ihnen leben mit Demenz. Besonders oft gehen Imad und Charlotte mit ihnen in den nahegelegenen Park und schauen den Kindern in der Gegend beim Spielen zu. Die Pflegekräfte haben für solche Ausflüge in kleinen Gruppen keine Zeit.
„Nach Schätzungen werden etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zuhause von ihren Angehörigen – meist von Frauen – gepflegt.“
Junge Menschen wie Charlotte und Imad, Technologien wie Virtual-Reality-Brillen können den Alltag im Heim aufhellen, die Pflegekräfte entlasten. Doch sie lösen ein – vielleicht das Problem - der Pflege nicht: Der Lohn von Pfleger:innen und Betreuer:innen in Krankenhäusern und Heimen oder zuhause ist sehr gering. „Das Problem der geringen Bezahlung ist keine Frage von Angebot und Nachfrage,“ sagt Monika Riedel. „Es braucht eine Aufwertung des Berufes.“
Das ist auch eine feministische Frage: Care-Arbeit wird insgesamt nicht oder schlecht bezahlt, merkt beispielsweise die Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky in einem Aufsatz zur COVID-19-Krise an. Sie meint: Die COVID-19-Krise habe die schon lange bestehende Care-Krise verstärkt. Denn eigentlich ist Care jetzt schon Kern unseres Wirtschaftssystems. Laut OECD-Berichten trägt unbezahlte Care-Arbeit zwischen 30 und 50 Prozent des BIP bei. Sie wird vor allem von Frauen verübt: Laut einer Zeitverwendungserhebung aus dem Jahr 2008/2009 leisten die Menschen in Österreich mehr unbezahlte als bezahlte Arbeit. Frauen leisten dabei doppelt so viel wie Männer.
Auch in Bezug auf die Pflege gilt: Nach Schätzungen werden etwa 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zuhause von ihren Angehörigen – meist von Frauen – gepflegt. Auch wenn diese wichtige Care-Arbeit bezahlt wird, dann meistens mit geringem Lohn. Grund dafür sind die patriarchalen Verhältnisse, so Villa Braslavsky. Es brauche ein Umdenken: „Care ist systemrelevant“, schreibt sie
„Wir beginnen gerade ein Genossenschaftsmodell mit Anstellung für die Betreuer:innen auszuarbeiten.“
In Österreich ist die Finanzierung Sache der Länder und Gemeinden. Diese haben aber nur geringe eigene Steuereinnahmen zur Bewältigung ihrer Aufgaben und bekommen daher im Rahmen des Finanzausgleiches festgesetzte Anteile der Steuereinnahmen vom Bund. Dieses Geld wird vom Bund mehr oder weniger pro Kopf vergeben – wie hoch der Bedarf an Pflege in einer Gemeinde ist, ob dort viele ältere Menschen wohnen oder die Bevölkerung eher jung ist, wird nicht mitbedacht. „Dieser Finanzausgleich sollte bedarfsorientiert sein“, so Riedel.
Auch deshalb finanzieren viele Familien oder Pflegebedürftige ihre Daseinsvorsorge privat. Das ist auch für die IG-24 ein Problem: „Wir fordern ein staatlich organisiertes Anstellungsverhältnis“, sagt Durisova. Die IG-24 will eine Lösung, die für Betreuer:innen ein besseres Gehalt und für die Familien, die Betreuung brauchen, keine zu große finanzielle Bürde bedeutet. „Die Betreuer:innen privat anzustellen, ist für die Familien nicht leistbar. Wenn sich die Situation der Pflege verbessern soll, muss das der Staat in die Hand nehmen. Hier darf nicht gespart werden.“
Ein staatliches Modell der 24-Stunden-Betreuung ist das langfristige Ziel der IG- 24. Inzwischen fordern sie bessere Arbeitsbedingungen und haben eine eigene Idee: „Wir beginnen gerade ein Genossenschaftsmodell mit Anstellung für die Betreuer:innen auszuarbeiten“, sagt Durisova. „Wir sind noch ganz am Anfang, aber ich halte diese Arbeit für sehr wichtig. Es muss eine Körperschaft geben, die die Betreuung organisiert.“ In der Genossenschaft sollen die Betreuer:innen und die Betreuungsfamilien Mitglieder sein, beide sollen einzahlen und Anteile bekommen. „Wir wollen Betreuer:innen und Klient:innen sensibilisieren, dass es bessere Organisationsmodelle für die Pflege gibt.“ Langfristig sei das aber Aufgabe des Staates. Darin sind sich Durisova und Betreuerin Csilla F. einig.
Csilla möchte aber nicht auf die Politik warten. Sie plant den österreichischen Staat wegen der Scheinselbstständigkeit der Betreuer:innen zu verklagen. „Irgendjemand muss ja einen Musterprozess führen“, sagt sie. „Irgendetwas muss geschehen.“ Bisher hat sie nur Absagen von Rechtsanwaltskanzleien bekommen.